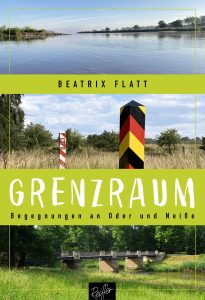Seit wann gibt es das wissenschaftliche Fachgebiet „Border Studies“?
Weber: Durch die politische Wende und die gesellschaftspolitischen Umbrüche nach 1989 entwickelte sich zwischenzeitlich die Idee einer grenzenlosen Welt. Aus heutiger Sicht betrachtet, war das eher eine Utopie. Man begann in den 1990er Jahren und besonders mit Beginn der 2000er Jahre, Grenzräume über die Landesgrenzen hinweg als eigene Strukturen zu betrachten und zu erforschen.
Wenzelburger: Der deutsch-französische Grenzraum war auch schon vor 1989 Gegenstand der Forschung, aber es wurden meist nur einzelne Aspekte wie zum Beispiel Arbeitsmigration beleuchtet. In der jüngeren Zeit werden Grenzräume umfassender untersucht, in meiner Disziplin – der Politikwissenschaft – erst seit Beginn des neuen Jahrtausends.
Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Grenzregionen Polen-Deutschland und Deutschland-Frankreich?
Wenzelburger: An der Westgrenze Deutschlands gibt es eine lange Zeit der erprobten Wechselbeziehungen. Deshalb gibt es in der Grenzregion Frankreich-Deutschland ein anderes Niveau und eine andere Tiefe der Beziehungen. An der Ostgrenze Deutschland sind diese Netzwerke noch im Aufbau und haben deshalb noch nicht die Tiefe und Breite.
Ein weiterer Unterschied zwischen West- und Ostgrenze sind die unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen. Bestimmte Dinge müssen in Warschau und können nicht auf regionaler Ebene entschieden werden, wobei die aktuelle politische Konstellation sicherlich nicht hilfreich ist. Menschen in der Grenzregion sehen eher die Notwendigkeit für bestimmte Zusammenarbeit oder grenzüberschreitende Projekte, während man das zurzeit in Warschau anders sieht.
Aber Frankreich ist genauso zentralistisch organisiert. Müssen Entscheidungen, die die Grenzregionen betreffen, nicht über Paris laufen?
Wenzelburger: Doch, generell schon. Aber an der französischen Grenze gibt es aufgrund der langen Zusammenarbeit bei Kommunalpolitikern ein gewisses Selbstbewusstsein, so dass Entscheidungen in Paris manches Mal eher durchgewunken werden. Außerdem haben gesetzliche Änderungen in den vergangenen Jahren – etwa die „loi 3Ds“ – den unteren politischen Ebenen in Frankreich einen etwas größeren Spielraum eröffnet, selbst zu gestalten.
Weber: Es ist vor allem die politische Lage im jeweiligen Land, die Entscheidungen und Projekte vereinfachen oder verkomplizieren. An der Ostgrenze sind auf lokaler Ebene Wunsch und Wille zur Zusammenarbeit oft viel stärker als auf nationaler Ebene. Deshalb klappt der informelle Austausch sehr gut, aber sobald es um Entscheidungen oder Finanzierung geht, müssen die entsprechenden Stellen in Warschau eingeschaltet werden.
Wenzelburger: Das ist aber kein polnisches Problem, das gleiche könnte in Frankreich auch passieren, wenn es hier politische Veränderungen gibt. Wenn die Partei Rassemblement National an die Macht käme, könnte das auch zu Rückschritten führen. Allerdings ist das in den Grenzregionen Frankreich-Deutschland unter anderem durch gewachsene Strukturen und politische Übereinkünfte wie den Aachener Vertrag von 2019 gar nicht so leicht möglich. Gemeinsame Institutionen oder Verwaltungsstrukturen wären nicht so leicht aufzulösen.
Gibt es mit Polen einen vergleichbaren Vertrag?
Weber: 1991 wurde der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet, der eine Basis für die grenzüberschreitende Kooperation bildet.
Die deutsche Stadt Guben und die polnische Stadt Gubin haben beispielsweise eine gemeinsame Kläranlage. Solche Einrichtungen der Infrastruktur sind in der Regel dauerhaft und können bei einem Regierungswechsel nicht einfach aufgelöst werden.
Genau. Wissenschaftlich spricht man hier von versunkenen Kosten, die Pfadabhängigkeiten erschaffen. Sprich: Wenn ich einmal Geld investiert und Institutionen (mit Personal) geschaffen habe, können sie nicht so einfach wieder abgeschafft werden. Denn alle anderen Akteure haben sich darauf eingestellt und ihre eigenen Handlungen darauf ausgerichtet, dass die Institutionen existieren und gewisse Aufgaben übernehmen. Insofern haben solche Einrichtungen dann häufig unabhängig vom politischen Tagesgeschäft Bestand.
Können starke Grenzregionen mit intensiven Verflechtungen nationalstaatliches Denken eindämmen?
Wenzelburger: Eine Studie aus dem Jahr 2005 zur deutschfranzösischen Grenzregion zeigt, dass Menschen in den Grenzregionen an der Westgrenze Deutschlands etwas europäischer orientiert sind als die Menschen im Rest des Landes. Das zeigt sich aber nicht in Frankreich. Wir haben zudem jüngst nochmals neue Daten ausgewertet und die bestätigen das Muster, wobei Menschen an der deutschen Ostgrenze sich nicht stärker mit Europa verbunden fühlen als Durchschnittsdeutsche aus dem Landesinnern. Aber das sind alles Momentaufnahmen – es gibt leider aktuell noch viel zu wenig detaillierte Daten über die Grenzregionen und somit können wir als Wissenschaftler dazu wenig klare Aussagen machen.
In Europa bzw. im Schengenraum war es in den letzten Jahrzehnten selbstverständlich, dass Grenzen offen sind. Plötzlich wurden diese während der Pandemie teilweise geschlossen. Was bedeutete das für die Grenzräume?
Weber: Die zeitweisen verstärkten Grenzkontrollen und teilweisen Grenzschließungen haben viele wachgerüttelt, denn vielen war gar nicht bewusst, wie stark die Verflechtungen in den Grenzräumen tatsächlich sind. Und auch hier zeigte sich der enorme Forschungsbedarf.
Ein Vorteil der Pandemie war, dass sich die Akteure auf lokaler Ebene noch besser kennengelernt haben – und dies gilt für beide Grenzräume Deutschland-Frankreich und Deutschland-Polen. Die Entscheidungswege müssen zwar jetzt immer noch eingehalten werden, aberdieses Engagement auf lokaler und regionaler Ebene kann man in Warschau oder Paris nicht mehr einfach ignorieren.
Welche Aktivitäten in den Grenzregionen haben den größten Einfluss auf das Zusammenwachsen zweier Staaten: wirtschaftliche Verflechtung, Arbeitsmigration, interkommunale Zusammenarbeit, Sprache, Bildung, Kultur, Naturschutz, Verkehr …?
Weber: Das ist eine schwierige Frage. Arbeitsmigration heißt nicht unbedingt, dass man sich mit dem Nachbarn verbunden fühlt. Im Gegenteil: Arbeitsmigration und unterschiedliche Löhne in den betreffenden Ländern können auch zu Konflikten führen. Wir wissen wiederum von positiven Effekten durch Zusammenarbeit auf politischer und administrativer Ebene. Hier werden persönlicher Austausch, Arbeitsmarkt und Konsum als wichtige Punkte identifiziert.
Wenzelburger: Wenn man die Entwicklung der deutsch-französischen Grenzregionen betrachtet, spielten die Wirtschaftsbeziehungen eine große Rolle. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, auch Montanunion genannt, war der erste große Schritt der Europäischen Integration, also der immer enger werdenden politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Europa. Und dann kamen erst die weiteren Integrationsschritte bis hin zur Sozialpolitik. Insofern könnte man erwarten, das beginnende Verflechtung zu noch mehr Verflechtung auch in Grenzregionen führt.
Und welche Rolle spielt die Sprache?
Weber: Ein gegenseitiges Sprachverständnis ist hochgradig relevant. Es geht dabei nicht um absolut perfekte Sprachkenntnisse der Sprache des Nachbarlandes, sondern vielmehr um zentrale Grundlagen, das heißt, um eine funktionale Mehrsprachigkeit.
Wenzelburger: Über die Sprache lernt man auch die Kultur des Nachbarn kennen. Auf der deutsch-französischen Ebene klappt es mit der Sprache ganz gut. Viele Menschen in der Grenzregion können die Sprache des jeweiligen Nachbarlandes. In den deutsch-polnischen Grenzregionen sind Sprachkenntnissen auf beiden Seiten der Grenze noch nicht so ausgeprägt, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hemmen könnte.
Wäre es eine Alternative, sich auf Englisch als gemeinsame Sprache zu einigen?
Weber: Nicht durchgehend. Es gibt mitunter Verluste bei der Verständigung, wenn die Kommunikation über eine dritte Sprache läuft. Das hat sich in der Vergangenheit sowohl beim Aushandeln von Verträgen in englischer Sprache als auch bei Konferenzen gezeigt.
Grenzregionen liegen an den Rändern von Nationalstaaten. Welchen Beitrag können Grenzräume mit starken Verflechtungen zu einem vereinten Europa leisten?
Weber: Die Europäische Kommission hat im Lichte der Covid-19-Pandemie Grenzregionen als „living labs“ der Europäischen Integration bezeichnet. In Grenzregionen können Vorzüge offener Grenzen und enge Verflechtungen sehr aktiv erlebt werden. Wird hier eng kooperiert und finden damit hier enge Austauschbeziehungen statt, kann dies über die nationalstaatlichen Nahtstellen einen Beitrag zu einer Weiterentwicklung der EU leisten.
Vielen Dank für das Gespräch.